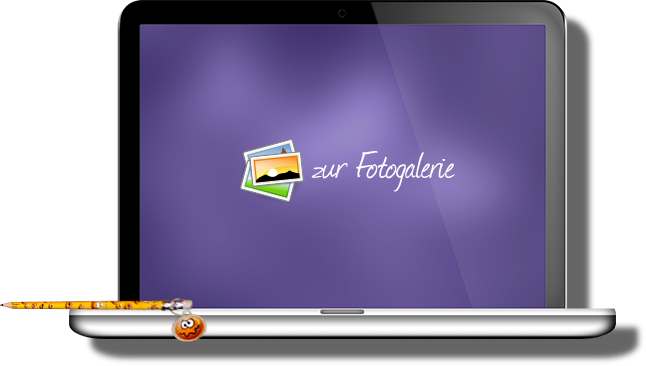Weißes Gold
 Gestern wurde ausgiebig der Weltmilchtag gefeiert. Im Freilichtmuseum Großgmain luden Landwirtschaftskammer und Bauernbund zu einem Aktionstag ein.
Gestern wurde ausgiebig der Weltmilchtag gefeiert. Im Freilichtmuseum Großgmain luden Landwirtschaftskammer und Bauernbund zu einem Aktionstag ein.
In vielen Medien wurde die Milch und damit die Molkereien durch Werbeeinschaltungen groß ins Bild gerückt.
Was nirgends erwähnt wurde – am 1. Juni ist gleichzeitig der Weltbauerntag. Vielleicht wird der unter den Teppich gekehrt, weil es dazu kaum Jubelmeldungen gibt. 1995 zum EU Beitritt gab es noch 293.000 land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Im Vorjahr waren es nur noch 167.500. Und das Sterben geht unaufhaltsam weiter.
Es tut einem um jeden Hof leid. Das ist nicht nur ein Desaster für die betroffenen Familien, denen dieser Schritt sicher nicht leicht fällt, sondern ein Problem, das Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft hat. Das ist ja immer auch ein Stück Geschichte und Dorfleben, das hier für immer verloren geht. Ich will mich hier gar nicht auf die Debatte einlassen, was in der Agrarpolitik alles schief läuft, sondern einfach zum Nachdenken anregen.
Vieles können wir nicht beeinflussen, aber meistens doch mehr als uns bewusst ist oder wir wahrhaben wollen. Weil es halt unbequemer ist, das Biofleisch vom Bauer des Vertrauens zu beziehen, als die fertig verpackte Tasse im Supermarkt mit zu nehmen. Der Konsument will heute alles möglichst praktisch, schnell und alles auf einmal einkaufen, das haben mir in letzter Zeit gleich mehrere Direktvermarkter bestätigt. Selbst unmittelbare Nachbarn würden Eier und Gemüse lieber gleich beim Supermarkt kaufen, statt am Biohof.
Dabei sind die Beteuerungen zu den regionalen Produkten in aller Munde. Aber das scheint mehr Theorie als Praxis. Es redet ja auch jeder vom Ausbau des öffentlichen Verkehrs, aber keiner benützt ihn..
Übrigens, der Tag wurde erst 2002 von der UNO ausgerufen, wie viele dieser Gedenktage, für eine aussterbende Spezies kreiert werden. Den Milchtag gibt es hingegen schon mehr als 50 Jahre. Damals sollte der Konsum angekurbelt werden, weil das weiße Gold als besonders gesundes Getränk galt. Heute badet Europa in Milchseen, aber die Bauern sterben aus.
Irre, findet eure Pinzgauerin
P.S.: Fällt mir gerade nachträglich noch dazu ein: Bei uns am Hofe und auch bei den Nachbarn haben sich früher einige Leute noch täglich frische Milch geholt. Das hat sich völlig aufgehört. Pasteurisierter Tetrapak ist heute beliebter als das Produkt direkt von der Kuh.